Dr. Johannes Gemkow
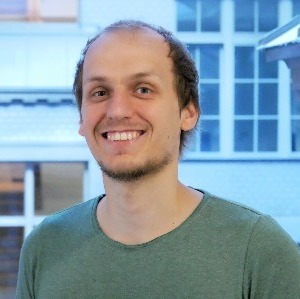
Johannes Gemkow ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig im Bereich Medienpädagogik. Johannes Gemkow studierte an der Universität Leipzig (BA) und der Universität Halle-Wittenberg (MA). In seinem aktuellen Forschungsprojekt am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt untersucht Gemkow die Bedeutung von Social Media für die politische Mediensozialisation Jugendlicher. Weitere Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Medien- und Informationskompetenz, Mediatisierung, Technik- und Wissenssoziologie sowie qualitative Sozialforschung. Johannes Gemkow ist Mitglied der European Communication Research and Education Association (ECREA), der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) und der Gesellschaft für Medienpädagogik- und Kommunikationskultur (GMK).
Zum Vortrag
Gesellschaftliche Polarisierung, die Emotionalisierung komplexer Problemstellungen oder die Verbreitung alternativer Fakten: Sind das junge Phänomene oder alte Erscheinungen in neuem Gewand? Ist das Internet daran schuld? Wenn ja, wie können wir lernen, soziale Medien mit Sensibilität für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu nutzen?
Seit rund 20 Jahren erleben wir durch die flächendeckende Verbreitung und Nutzung des Internets einen Wandel. Dieser lässt sich vor allem auf drei Aspekte kondensieren. Der erste Punkt bezieht sich auf die neue Rolle der Nutzer:innen, die mit gestiegenen Eingriffsmöglichkeiten von einem weitestgehend passiven Status zu Sender:innen werden konnten. Gleichzeitig ist zweitens das Mitgestaltungsrecht als liberales Versprechen des Internets mit dem Bedeutungsgewinn verschiedener Plattformen deutlich eingeschränkt worden. Drittens haben sich in diesem Prozess gesellschaftspolitische Einflussräume entwickelt, die populistische bis extremistische Dynamiken befeuern können – wie man sie etwa bei der Live-Inszenierung des Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 auf sozialen Medien sah, in identitätspolitische Foren auf Facebook und Telegram oder auch mit dem Bedeutungsgewinn populistischer Politik auf sozialen Medien wie TikTok, Instagram und X.
Populistische Posts sind geprägt von positiven Emotionen wie Stolz und Zusammengehörigkeit, aber auch von negativen Emotionen wie Aggression, Wut und Ärger. Es gibt stereotypische Rollenklischees: Männliche Personen präsentieren sich als stark, solidarisch, soldatisch. Frauen, die sogenannten Tradwives, machen sich für den Erhalt traditioneller Frauenbilder stark.
Populistische und extremistische Parteien haben mit ihrer emotionalen, auf Tabubrüchen, Provokation und Feindbildern basierenden Kommunikation ein autoritäres Verständnis, das einer Demokratie entgegensteht. Die Algorithmen der sozialen Medien belohnen das Extreme, das Tabubrechende, das Provokante mit drastischen Metaphern, also diese hoch emotionale, skandalisierende Kommunikation, die fast automatisch Aufmerksamkeit erzeugt. Denn das ist ja das Paradigma sozialer Medien: Aufmerksamkeit bekommen.
Akteure – egal ob politische, journalistische oder pädagogische – die auf demokratischem Fundament stehen, haben es mit ihrer Kommunikation in den sozialen Medien bei diesen Bedingungen schwieriger. Hier müssen Wege der richtigen Ansprache erst etabliert werden. Begleitet werden muss eine Demokratisierung sozialer Medien von rechtlichen Rahmendbedingungen der Plattformen und politischer (Medien-)Bildungsarbeit, vor allem mit Jugendlichen.


