Future of Social Content
Social Content ist künftig noch persönlicher, unperfekter, dialogischer, emotionaler, synthetischer und auf noch mehr verschiedene Plattformen fragmentiert. Nicht nur politische Akteure, sondern auch Unternehmen und Institutionen müssen sich darauf einstellen, dass die Qualität der Inhalte entscheidend
für die Zukunft von Social Content sein wird.
Text: Martin Fuchs
Die drei mit Abstand erfolgreichsten Videos von Parteien und Politikerinnen und Politikern im vergangenen Bundestagswahlkampf 2025 erzielten zusammen über 60 Millionen Views. Allein auf Tik Tok. Zu sehen gab es: Einen Tortenwurf auf den damaligen FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner; ein Reaction-Video des damaligen Bundeskanzlers auf das Video des bekannten Creators Brooklyn und seine Forderung “Olaf Scholz, senk die Preise!” und die Bundestags-Brandrede der Linken-Spitzenkandidatin Heidi Reichinnek, als Reaktion auf die gemeinsame Abstimmung der CDU/CSU-Fraktion mit der AfD bei einem Entschließungsantrag zur Migrationspolitik.
Authentische Kommunikation auf Augenhöhe
So verschieden alle drei Videos inhaltlich, von der Ästhetik, der Dramaturgie und auch der Zielgruppe sind, so zeigen sie aktuelle wie künftige Erfolgsfaktoren für “Social Content”: In allen Videos stehen politische Persönlichkeiten im Mittelpunkt. Die Parteien finden, wenn überhaupt, nur am Rande Erwähnung. Die Personalisierung der Kommunikation hat durch Social Media in den letzten Jahren stark zugenommen und wird auch künftig den Social Content prägen. Institutionen und gesellschaftlich relevante Akteure wie Parteien, Medienmarken oder auch Unternehmen verlieren zunehmend an Relevanz, was die Wahrnehmung und Akzeptanz der gesendeten Informationen und die Meinungsbildung im digitalen Raum angeht. Das Vertrauen in die authentische Kommunikation von Menschen, die direkt und auf Augenhöhe mit den Nutzenden kommunizieren, ist größer als in “Black box”-Accounts, auf denen ein Marken-Logo strahlt. Aus diesem Grund werden neben den Gesichtern von CEOs, Chefredaktionen oder Parteivorsitzenden noch mehr Corporate Influencer sowie Inhouse-Creator Inhalte präsentieren und versuchen, Institutionen ein nahbares Antlitz zu geben.
Quick & dirty statt Hochglanzoptik
Das bedeutet aber auch, dass Inhalte nicht mehr in Hochglanz-Optik produziert werden müssen: Das verwackelte Video aus der Bahn, hinter der Bühne oder aus dem unaufgeräumten Redaktionsbüro erzeugt mehr Authentizität als der perfekte im TV-Standard produzierte Imagefilm.
Quick & dirty ist der neue Qualitätsstandard. Aber auch externe Creator werden wichtiger für die Verbreitung eigener Inhalte. Dafür muss das digitale Vorfeld stärker in den Blick genommen und gepflegt werden. Die Communities müssen aktiver in Content-Prozesse eingebunden werden – von Co-Creation über Abstimmungen bis hin zu exklusivem Content. Damit Nutzende und Micro-Influencer bzw. Influencerinnen eigene Inhalte aufgreifen, müssen diese, egal ob Audios, Videos, Memes, Texte oder andere Content Pieces reaktionsschnell erstellt und der Followerschaft zur Verfügung gestellt werden, damit diese damit eigenen Content produzieren können. Der Aufbau von belastbaren Beziehungen zu Creators auf allen relevanten Plattformen wird zum neuen Schwerpunkt des Community-Managements. Auf den meisten Plattformen erleben wir gerade einen fundamentalen Wandel der algorithmischen Sortierung von Inhalten. Nicht mehr die Beziehungen zu den Usern sind entscheidend für die Sichtbarkeit der Inhalte, sondern die Inhalte selbst. Durch die Abkehr vom Social Graph zum Content Graph werden die Absender und ihre gesellschaftliche Rolle immer weniger entscheidend für die Sichtbarkeit und Reichweite der Inhalte.
Qualität statt Quantität der Inhalte ist entscheidend
Jeder Nutzende, egal ob 14-jähriger Teenie oder 75-jährige Verbandschefin, kann mit qualitativ gutem Inhalt und ohne große Followerschaft und Werbe-Budgets Millionen User ansprechen. Teilweise werden fragmentierte Zielgruppen sogar besser erreicht als durch einzelne prominente große Leuchtturm-Accounts, die viele Inhalte an die breite Masse aussenden. Entscheidend ist künftig viel stärker die Qualität einzelner Inhalte, nicht mehr die Quantität. Postings sollten dabei auf die Interaktion und das Engagement hin optimiert werden, nicht auf den Zuwachs an Followerinnen und Likes. Text ist nicht tot (Hej Reddit). Aber die Entwicklungen auf allen großen Plattformen zeigen, dass Vertikal-Videos der Gold-Standard für Engagement und reichweitenoptimierte Inhalte sind. Sieben der zehn erfolgreichsten Instagram-Beiträge sowohl der Parteien als auch aller Spitzenkandidaten und -kandidatinnen im Bundestagswahlkampf 2025 waren Reels. TikTok hat es vorgemacht, Instagram, YouTube und selbst LinkedIn folgen: Vertikale Kurzvideos sind das Format der Zukunft.
Vertrauen aufbauen durch Deep Vertical Storytelling
Doch die reine Welle aus „quick content“ reicht nicht mehr. Die Bedeutung von Deep Vertical Storytelling, also durchdachte Serienformate, Bildungsinhalte oder Micro-Dokus im Hochformat, nimmt zu. Künftig wird es nicht mehr reichen, nur kurze und „snackable“ Inhalte zu erstellen, Tiefe und Struktur der Verticals werden wichtiger, so gewinnt man Aufmerksamkeit und baut Vertrauen auf. Die anfangs erwähnten drei TikTok-Videos haben noch eine Gemeinsamkeit: Sie sind Reaction-Videos. Also die Reaktion auf andere Nutzende und Diskurse, die aktuell Menschen bewegen. Christian Lindner reagiert smart und spontan auf den Tortenangriff, Olaf Scholz reagiert ausgeruht und sachlich auf ein seit Monaten von den Nutzern gefeiertes virales Format, und Heidi Reichinnek reagiert hochemotional am Rednerpult auf eine Abstimmung. Damit zeigen alle drei Akteure, dass sie Diskursfähigkeit besitzen und nutzen gekonnt die bestehende Aufmerksamkeit, die andere geschaffen haben, um eigene Themen und Positionen zu platzieren. Die Fähigkeit, in Echtzeit reaktionsfähig zu sein, wird in Zukunft noch wichtiger. Die Voraussetzungen dafür: Diskurse engmaschig beobachten, die Relevanz für die eigenen Themen erkennen und die Konzeption sowie Produktion der eigenen Inhalte auf hohem Niveau möglichst zeitnah folgen lassen. Die Entwicklung hin zur Echtzeitkommunikation zeigt sich auch am Trend zum Livestreaming. Die Chance der User, live bei der Erstellung der Inhalte dabei zu sein, hat einen großen Reiz. Das Unvorhergesehene, das nicht Perfekte, das nicht durchchoreografierte Unterhaltungserlebnis, das Nutzenden ermöglicht, auch in Echtzeit durch Fragen und Interaktion Teil der Inhalte-Erstellung zu werden, wird weiter boomen. Vermutlich ist das auch eine Reaktion auf den stark wachsenden Anteil synthetischer und eben nicht authentischer Inhalte?
Trend zu Kombination aus KI und menschlicher Komponente
Künstliche Intelligenz und speziell generative KI-Tools wie ChatGPT, Midjourney oder Sora revolutionieren schon heute die Content-Erstellung. Von Texten über Bilder bis hin zu Videos. Denn automatisierter Content spart Zeit und Kosten und beschleunigt so die Inhalteproduktion und passgenaue Aufbereitung für verschiedene Zielgruppen und Plattformen. Doch der Trend geht klar in Richtung kombiniertem Inhalt, aus KI und menschlicher Komponente. Die effiziente Produktion von Inhalten wird durch authentische Geschichten, kulturelle Nuancen und echte Emotionen veredelt.
Die skizzierten Entwicklungen stellen nicht nur politische Akteure vor große Herausforderungen. Keine der aktuell relevanten Plattformen wurde geschaffen, um einen sachlichen politischen Diskurs zu ermöglichen. Nichtsdestotrotz finden Politik und politische Themen aber in vielen Feeds statt. Laut ARD Media kommen 56% aller Nutzenden auf Facebook, 54% auf Twitter/X, 48% auf Tik Tok, 45% auf Instagram und 24% auf Snapchat wöchentlich einmal mit politischen Informationen in Kontakt. Bei unter 30-Jährigen liegen die Werte noch deutlich höher.
Demokratiefördernde Inhalte brauchen emotionalen Trigger
Die Plattformen sind auf Unterhaltung optimiert: Die Wesensverwandtschaft der Erfolgskriterien der Algorithmen und polarisierender emotionaler Kommunikation führt dazu, dass es sachlich-informierende Inhalte schwerer haben, große Reichweiten zu erzielen als populistischer Content. Aus diesem Grund brauchen auch demokratiefördernde Inhalte einen emotionalen Trigger. Aber anstatt auf Wut und Angst zu setzen, sollten positive Emotionen wie Optimismus, Zuversicht, Liebe und Inspiration im Vordergrund stehen. Die auf Social Media erzeugten Stimmungen haben Einfluss auf die gesellschaftliche Stimmung, auf die Auswahl der diskutierten Themen und immer öfter auch auf reale politische Aktivitäten, wie zuletzt die gescheiterte Wahl einer für das Bundesverfassungs-gericht vorgeschlagenen Kandidatin im Juli 2025 zeigte. Gezielte Stimmungsmache und digitale Kampagnen nehmen Einfluss auf die Willens- und Meinungsbildung. Auch mit Hilfe von Hate Speech.
Hass im Netz verhindert die demokratische Teilhabe am digitalen Diskurs
Die Sensibilität für digitale Gewalt hat in den letzten Jahren zugenommen. Gesetzgebung und Strafverfolgung gehen konsequenter gegen strafbare Inhalte vor, wie beispielsweise die bayerische Initiative „Justiz und Medien – Konsequent gegen Hass“ zeigt. Auch das zivilgesellschaftliche Engagement gegen Hass im Netz ist stetig ausgebaut worden. Trotzdem wird Hass weiter einen relevanten Anteil am Content haben, auch wenn er nur für bestimmte Gruppen sichtbar wird. Hier braucht es eine noch schnellere und konsequentere Strafverfolgung, weiteren politischen Druck auf die Plattformen, Nutzende noch besser zu schützen. Außerdem sind solidarisierende Inhalte breiter gesellschaftlicher Gruppen gefragt, um den betroffenen Zielgruppen die demokratische Teilhabe am digitalen Diskurs zu ermöglichen.



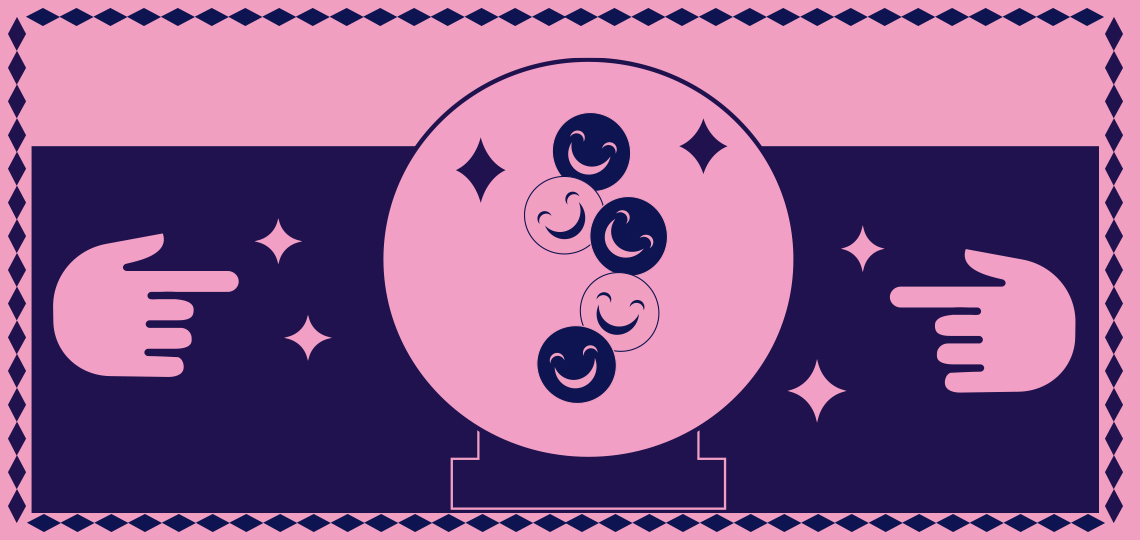
 Alle Artikel
Alle Artikel

